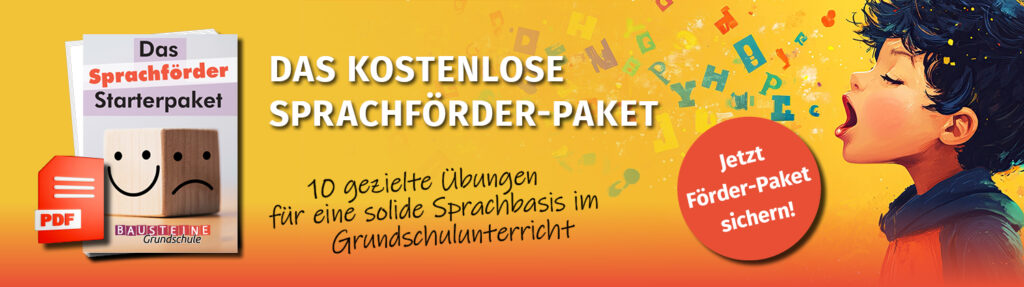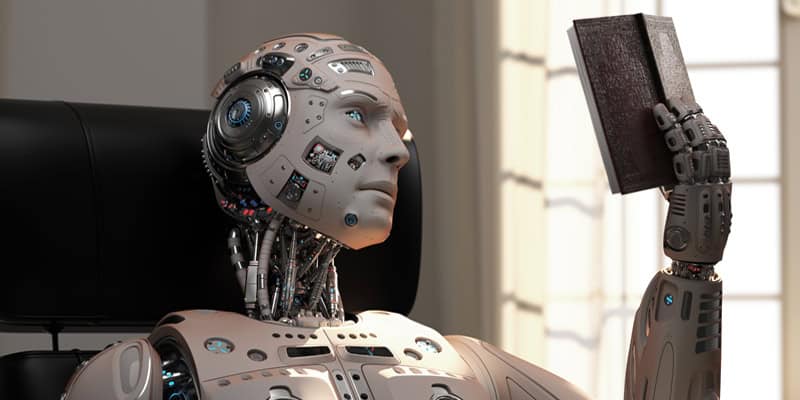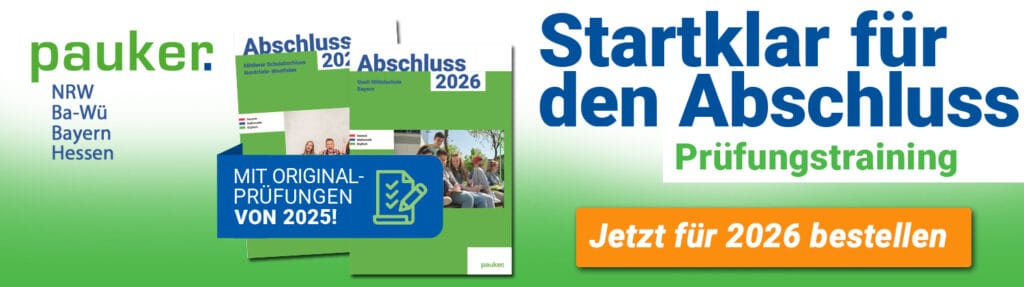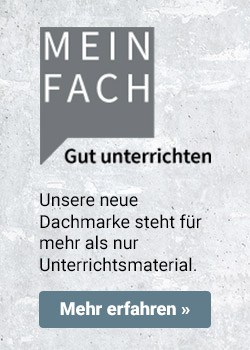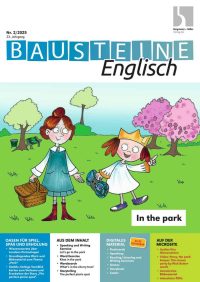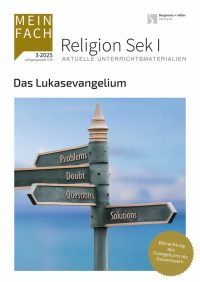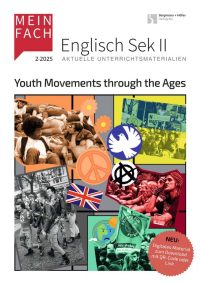Deutliche Verschlechterungen im Fach Deutsch, während die Kompetenz bei Englisch so groß wie nie ist. Der IQB-Bildungstrend zeigt ein gemischtes Bild der Leistungen an deutschen Schulen.
In regelmäßigen Abständen untersucht das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, (IQB) wie die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzziele der Bildungsstandards erreichen, welche durch die Kultusministerkonferenz (KmK) definiert wurden. Die nun veröffentlichte Studie untersuchte 2022 die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler der neunten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Englisch.
Zusätzlich zu den Fähigkeiten in den Bereichen – Lesen, Rechtschreibung und Zuhören wurden in der Studie zudem die geschlechterspezifischen Unterschiede sowie sozioökonomische und Migrationsunterschiede analysiert.
Leistungen im Fach Deutsch sind besorgniserregend
Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrend bestätigen eine Entwicklung, die bereits in der Iglu-Studie festgestellt wurde. Die Fähigkeiten im Fach Deutsch an den Schulen verschlechtern sich in einem beunruhigenden Umfang und Geschwindigkeit. „In hohem Maße besorgniserregend“ bezeichnen die Studienautoren die Verschlechterung der Kompetenzergebnisse und dies unabhängig vom Bundesland und Schulform.
Im Vergleich zur letzten Erhebung im Fach Deutsch 2015 habe sich der Leistungsdurchschnitt im Bereich Lesen um 25 Punkte verschlechtert, was in etwa dem Lernfortschritt eines ganzen Schuljahres entspreche. Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler erreiche nicht die Minimalanforderungen beim Lesen, in Bremen sind es fast die Hälfte. Sogar im auf seine Bildungspolitik stolzen Bayern haben sich die Leistungen verschlechtert und liegen jetzt in etwa auf dem Level von Bremen aus dem Jahr 2009. Im gesamten Bundesgebiet verfehlten im Bereichen Lesen und Orthografie 9% der Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards, im Bereich Zuhören sogar 16%.
Als Grund für diese Verschlechterung sehen die Studienautoren eindeutig einen Zusammenhang zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Unterrichtsausfälle und der häufige und lange Fernunterricht mit einer nicht optimalen digitalen Ausstattung hätten zu den Lernrückständen geführt. Auch der größere Anteil an Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund sei bei dem Ergebnis zu beachten.
Gutes Englisch – Freizeitverhalten hat Auswirkungen
Optimismus dagegen verbreiten die Ergebnisse der Englischkenntnisse der Schülerinnen und Schülern. Um jeweils 3 Prozentpunkte sank der Anteil der Jugendlichen, welche die Mindeststandards verfehlten, beim Leseverstehen auf 24 beziehungsweise beim Hörverstehen auf 14 Prozent. Im Vergleich zur Erhebung von 2015 haben sich die deutschen Schülerinnen und Schüler bei ihrer Englischkompetenz um ein ganzes Schuljahr verbessert. Dies gilt ausnahmslose für alle Bundesländer (mit Ausnahme des Saarlands dort ist Französisch die erste Fremdsprache) und alle Schulformen.
Als Grund für diese Verbesserung wird vor allem das Freizeitverhalten der Jugendlichen gewertet. Die Schülerinnen und Schüler verbringen immer mehr Zeit online, sei es auf sozialen Netzwerken oder beim Gaming und der dort konsumierte Inhalt ist zu einem großen Anteil auf Englisch.
Geschlechterspezifische und soziale Unterschiede
Schon in früheren Studien wurde festgestellt, dass Mädchen im Durchschnitt ein höheres Kompetenzniveau erreichen als Jungen. Diese Entwicklung bestätigt sich im aktuellen Bildungstrend. Den größten Vorsprung wurde mit 49 Punkten im Bereich der Orthografie im Fach Deutsch festgestellt. Auch im Bereich Leseverstehen im Fach Englisch wurde mit 34 Punkten ein deutlicher, gelechterbezogener Unterschied von den Studienautoren festgestellt.
Eine ebenfalls bekanntes und leider nicht mehr überraschende Ergebnis ist die Bestätigung, dass die soziale Herkunft und der sozioökonomische Status der Eltern weiterhin einen deutlichen Einfluss auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler haben. Der Unterschied hat sich dabei im Vergleich zum Jahr 2015 nochmals verschärft.
Migration als Faktor
Der Anteil von Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund ist seit der letzten Studie 2015 um neun Prozent gestiegen. Während es in den ostdeutschen Flächenländern bei maximal 15% liegt, ist er mit über 50% in Berlin, Bremen und Hessen am höchsten. Die Untersuchungen ergaben in den beiden untersuchten Fächern einen Rückstand bei den Lernkompetenzen für Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, der allerdings im Fach Englisch geringer ausfiel als im Fach Deutsch. Die Mehrsprachigkeit in den migrantischen Familien sahen die Forscher als einen Vorteil für die Jugendlichen für das Fach Englisch. Auf der anderen Seite korreliere die Häufigkeit, mit der Deutsch als Sprache in den Familien gesprochen werde, mit den Fähigkeiten im Fach Deutsch.
Erfreuliche Befunde der Studie
Neben den für das Fach Deutsch unerfreulichen und für Englisch guten Ergebnissen stellten die Studienautoren noch zwei begrüßenswerte Ergebnisse fest. So waren ein Großteil der Schülerinnen und Schüler äußerst zufrieden mit ihrer Schule und sahen sich gut in die Klassen integriert. Auch die befragten Deutsch- und Englischlehrkräfte waren zufrieden mit ihrer Berufswahl. Obwohl der Beruf der Lehrerinnen oder der Lehrer viele Herausforderungen mit sich bringt, sagten die Lehrkräfte aus, dass sie mit großer Begeisterung unterrichten würden und ihr Beruf erfüllend sei.
Viele Grüße
Deine Lehrerinsel-Redaktion
Ausgaben passend zum Thema
- Der Weg zu (m)einem Beruf (Wirtschaft betrifft uns)
- Reflexion über Sprache (Deutsch betrifft uns)
- Identity and Belonging (Englisch betrifft uns)
Beiträge passend zum Thema
- Soziale Herkunft beeinflusst Gesundheit von Schulkindern
- Smartphones beeinflussen die Lernleistung
- Kindheit, Internet, Medien: KIM-Studie 2022 online