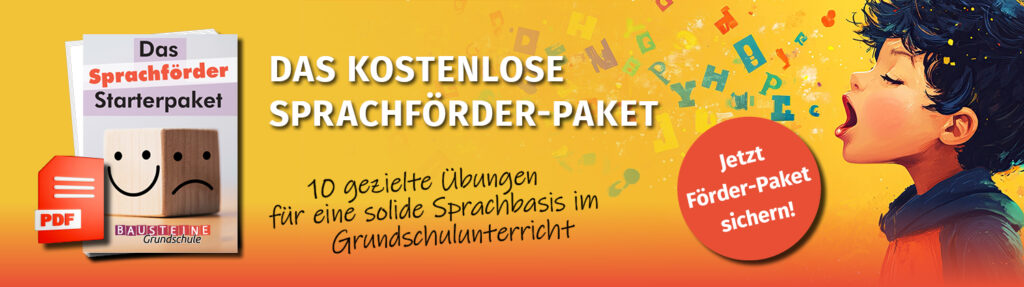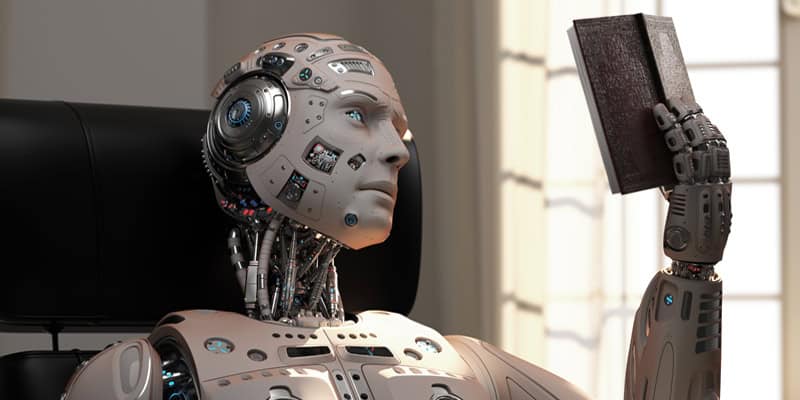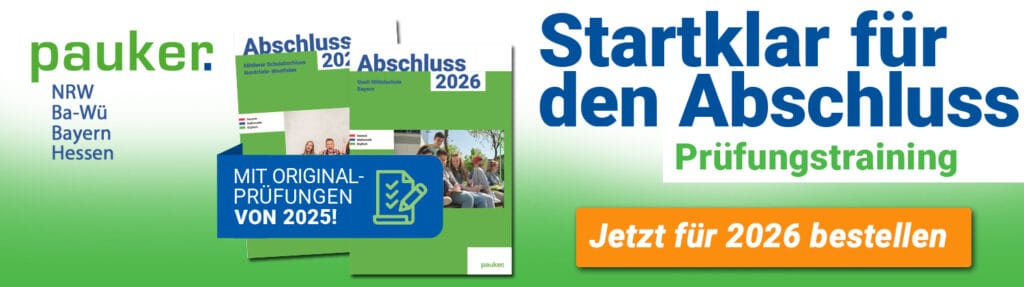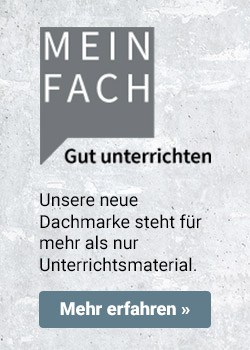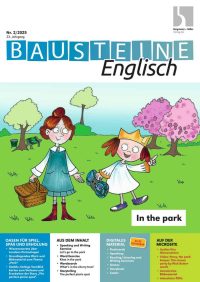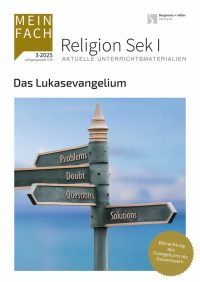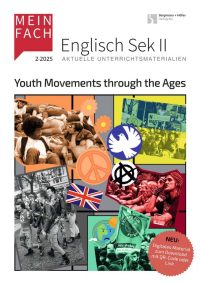Das Vorurteil der faulen Lehrkraft, welche andauernd frei haben, hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig in Deutschland. Zeit sich die Realität anzugucken und in die Zukunft der Arbeitszeitmodelle von Lehrkräften.
Vormittags recht, Nachtmittags frei. 12 Wochen bezahlter Urlaub in der Ferienzeit und dazu ist der Job ja schnell gemacht, als Lehrkraft einfach jedes Jahr die gleichen alten Unterlagen für den Unterricht benutzen. So oder so ähnlich lauten viele Vorurteile, die einem als Lehrkraft regelmäßig entgegenschlagen. Mit der Wahrheit hat das allerdings nichts zu tun, denn insbesondere die wöchentlichen Arbeitszeiten sind für Lehrkräfte häufig über dem, was bei einem Vollzeitjob üblich sind.
Mehr als 40 Stunden pro Woche ist Normalität
Bei einer Untersuchung der Universität Göttingen stellten die Forscher fest, dass die durchschnittliche Arbeitszeit von Lehrkräften im Schnitt bei 46:38 Stunden in der Schulzeit lag. In der Studie „Lehrkräftearbeitszeit in Deutschland“ der deutschen Telekomstiftung kommen die Studienautoren sogar auf fast 50 Stunden, die Lehrkräfte im Schnitt pro Woche für ihren Beruf leisten. Damit liegen Lehrerinnen und Lehrer deutlich über den üblichen 38-40 Stunden für einen Vollzeitjob in anderen Branchen.
56% der Lehrkräfte an Grundschulen und 62% der Lehrkräfte, die an einem Gymnasium unterrichten, berichten, dass sie sogar mehr als die 46,5 Stunden pro Woche arbeiten. Hinzu kommt, dass 65% der befragten Grundschullehrkräfte und 75% der Gymnasiallehrkräfte angaben, an mindestens 80% der Wochenenden zu arbeiten. Auch in der Nacht noch Aufgaben zu erledigen, ist dabei nichts Ungewöhnliches 13% der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen und 30 % am Gymnasium gaben dies an.
Unterrichtszeit und Arbeitszeit
Die Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und der praktischen Unterrichtszeit ist für die Beurteilung und das Verständnis der Belastung der Lehrkräfte essentiell. Wie viele Stunden pro Woche eine Lehrkraft unterrichtet, hängt vom Bundesland und der jeweiligen Schulform ab. Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen unterrichten zwischen 26 bis 28 Stunden pro Woche, während am Gymnasium die Bandbreite zwischen 22 und 27 Stunden in der Woche liegt.
Aufgrund der festen Stundenanzahl lassen sich die Zeiten für den Unterricht selber noch relativ gut planen, so gilt dies aber nicht für die Arbeiten, die außerhalb des Unterrichts anfallen. Klassenarbeiten korrigieren, Vorbereiten und Nachbearbeitung von Themen und Unterrichtstunden, Rückmeldungen an Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und zusätzliche Aufgaben in der Schule. Dies sind alles Arbeiten, die Lehrkräfte zusätzlich erledigen müssen. Der Fachkräftemangel an den Schulen tut sein Übriges, um die Situation für die Lehrkräfte zu verkomplizieren.
Urteil des EuGHs bringt Bewegung
In einem Urteil von 2019 legte der Europäische Gerichtshof (EuGH) fest, dass die gesamte geleistete Arbeitszeit vom Arbeitnehmer aufgezeichnet werden müsse. 2022 konkretisierte dies das Bundesarbeitsgericht, indem es feststellte, dass das Urteil vom EuGH bereits heute gelte und nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft. Die Arbeitgeber wurden damit gezwungen umgehend ein System zur Zeiterfassung bereitzustellen.
In Folge dieses Urteils kam es zu politischen Überlegungen, dass es Ausnahmen geben müsste und zwar für Angestellte in der Wissenschaft sowie an den Schulen. Die aktuelle Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günter-Wünsch (CDU) befürchtet, dass durch eine genaue Zeiterfassung die Attraktivität des Lehrerberufes leiden könnte. Katharina Günter-Wünsch: „Möglich sei das nur für die erteilten Unterrichtsstunden, nicht aber für die zahlreichen außerunterrichtlichen Tätigkeiten wie zum Beispiel die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Korrekturen, Eltern- und Schülerbesprechungen, Verwaltungsarbeiten, Aufsichten etc. Die dafür anfallenden Arbeitszeiten könnten nicht prognostiziert oder durch den Arbeitgeber überprüft werden. Es gehöre zum Berufsbild der Lehrkraft, dass sie ihre Aufgaben eigenverantwortlich und selbständig ausübt“
Neues Modell für die Arbeitszeit?
Das bis jetzt vorherrschende Deputatsmodell für die Arbeitszeiten von Lehrkräften, dass die Pflichtstunden für den Unterricht pro Woche vorgibt, könnte mit der Pflicht zur genauen Arbeitszeiterfassung womöglich enden. Da je nach Stufe, Fach, Aufgabe und Schule der Arbeitsaufwand für eine Unterrichtstunde extrem unterschiedlich sind. Das vorhandene Modell bietet nur wenig Flexibilität und fordert zugleich den Lehrerinnen und Lehrern viel ab.
Der Bildungsexperte Mark Rackels schlägt deshalb zwei Änderungen vor: Zum einen soll das Deputatsmodell auf ein Jahresarbeitszeitmodell, wie es bereits in Hamburg der Fall ist, umgestellt werden. Nach dem Abzug der Ferien und Wochenenden würden auf einer Jahresbasis die jeweiligen Wochenstunden berechnet. In diese Berechnung würden dann zu den Unterrichtsstunden alle weiteren Tätigkeiten ebenfalls zugerechnet. Zum anderen soll die Basis nicht mehr die einzelne Unterrichtsstunde sein, sondern sogenannte „Tätigkeitscluster“, welche mit zeitlichen Richtwerten berechnet werden. Rackels schlägt vier Cluster vor: Den Unterricht, unterrichtsnahe Tätigkeiten, professionelle Kompetenz (z.B. Fortbildungen) und allgemeine Aufgaben. Der Unterricht und die unterrichtsnahen Tätigkeiten sollen dabei mindestens 75% einnehmen. Tätigkeiten, die nicht direkt unterrichtsbezogen sind sollen dafür an anderes Personal ausgelagert werden, um die Lehrkräfte zu entlasten.
Viele Grüße
Deine Lehrerinsel-Redaktion
Ausgaben passend zum Thema
- Reflexion über Sprache (Deutsch betrifft uns)
- International Relations and Conflicts (Englisch betrifft uns)
- Zeitenwende (Religion betrifft uns)