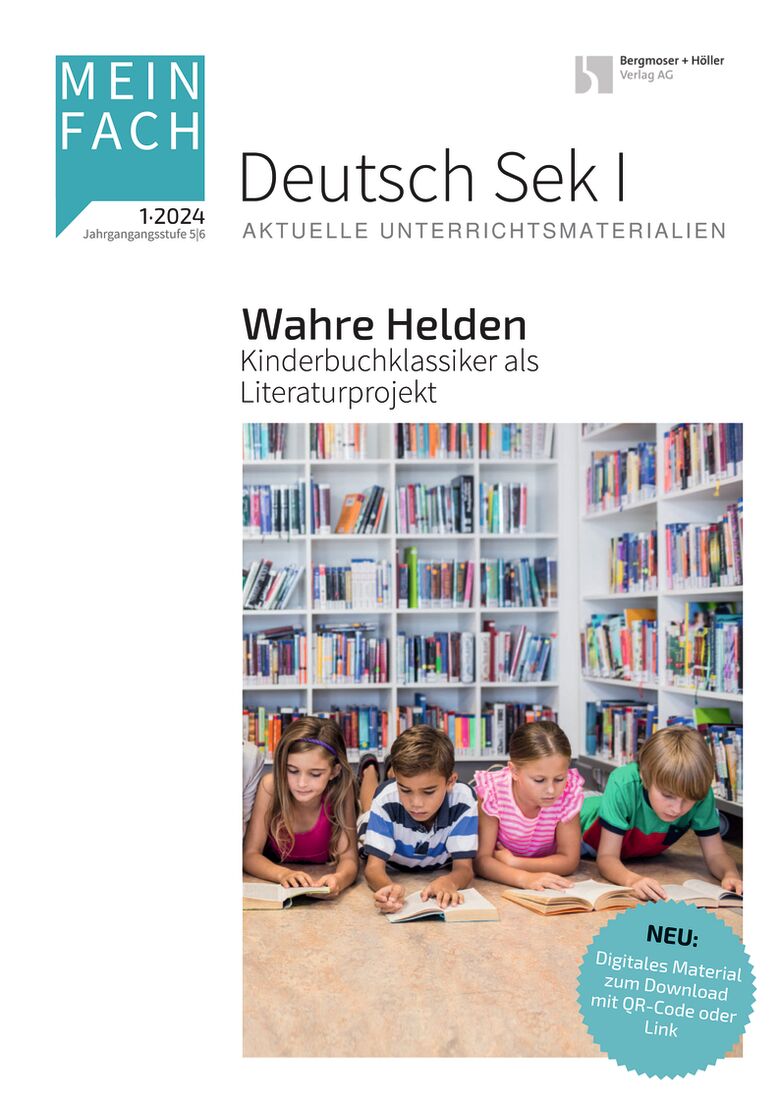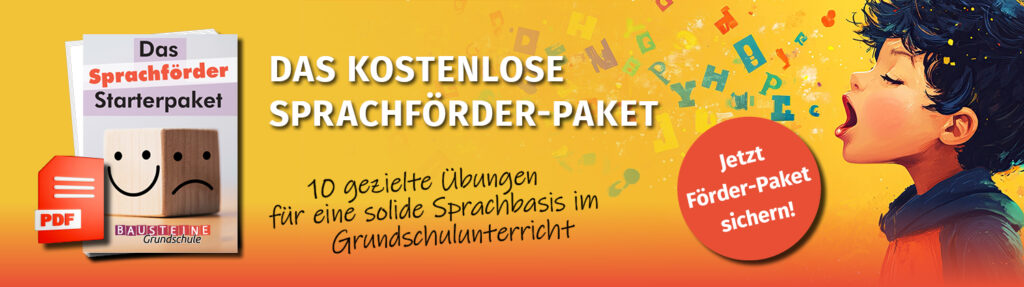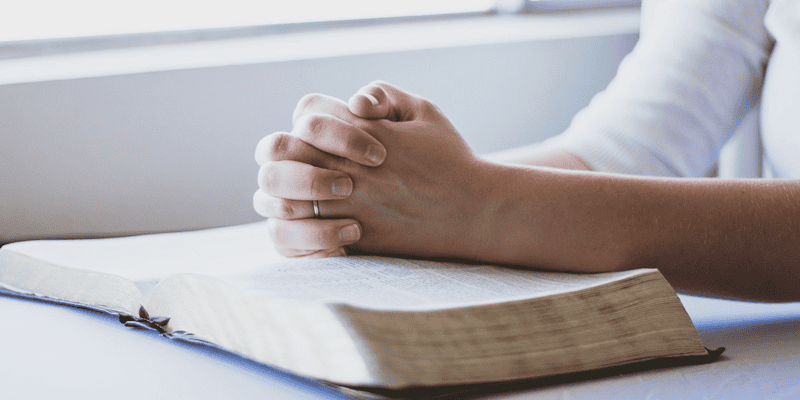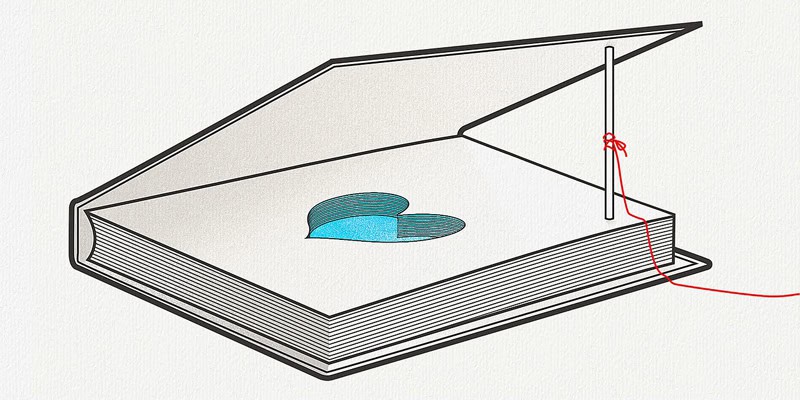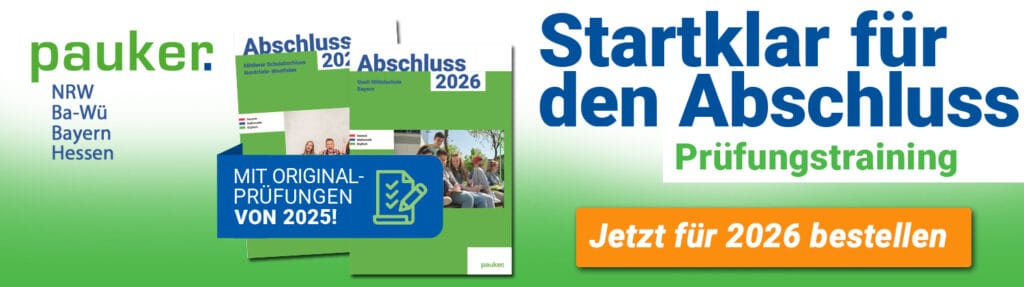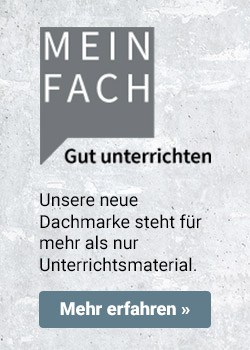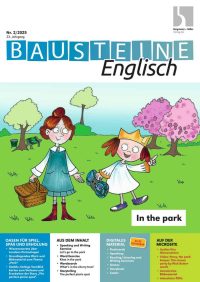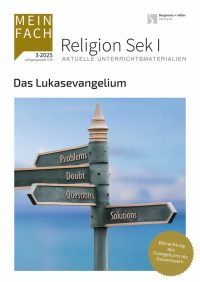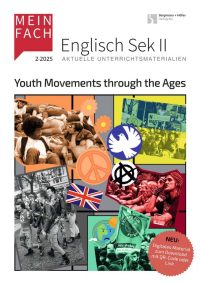Zensur ist so alt wie die Literatur selbst. Auch heute kommen immer wieder bedenkliche Begriffe und Absätze ins Gespräch, die in den „alten Klassikern“ der Schullektüren zu finden sind. Wie Lehrkräfte mit veralteter Sprache in Kinder- und Jugendliteratur und vor allem in der Schullektüre umgehen sollten, das ist und bleibt wohl noch länger Thema.
Der gesellschaftliche Diskurs über den richtigen Gebrauch von Sprache, welche Wirkung bestimmte Wörter entfalten können und wie man damit im Klassenzimmer umgehen sollte, ist ja – im Grunde – ein alter Hut. Im schulischen Rahmen entzündet sich die Debatte häufig an der Frage nach dem Umgang mit den „alten Klassikern“ der Literatur, wenn in diesen z. B. nach heutigem Gebrauch als rassistisch oder herabwürdigend geltende Wörter oder Vorurteile verwendet werden. Viele Lehrkräfte stehen bei dieser Debatte dann zwischen den Vorgaben des Lehrplans, ihren eigenen Vorstellungen der Unterrichtsgestaltung sowie zwischen den Meinungen von Schülerinnen und Schülern als auch deren Eltern.
Wie kommen Bücher in den Lehrplan?
In Deutschland gibt es keine einheitliche oder verbindliche Liste von Büchern, welche die Lehrkräfte einsetzen müssen. Es gibt zwar in einigen Bundesländern Listen mit Empfehlungen für Bücher, doch jede Lehrkraft kann eigenständig die Auswahl treffen, welche Bücher im Unterricht behandelt werden. Die Listen dienen daher eher der Orientierung bzw. der Inspiration und Unterstützung für den Unterricht. Die Kulturbehörden geben zudem einige Merkmale und Attribute vor, die ein Buch erfüllen sollte. Hierzu zählt z.B. die Relevanz eines Buches für eine Epoche oder ein Genre.
Einen Sonderfall stellen die Pflichtlektüren für das Zentralabitur dar, welche von den jeweiligen Bundesländern festgelegt werden. Ein Blick in den entsprechenden Literaturkanon zeigt, dass dieser von den Klassikern dominiert wird.
Rassistische Begriffe in Schullektüren
Regelmäßig neuen Schwung in die Debatte um rassistische Begriffe in Schulbüchern bringen Lehrkräfte selbst. So etwa der Schweizer Lehrer Philippe Wampfler, der in seinem Unterricht nicht mehr „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt lesen möchte, da dort das „N-Wort“ verwendet wird. Wampfler weist darauf hin, dass er für eine Umgebung ohne Rassismus in der Schule eintritt und Schülerinnen und Schüler keinen Text mit rassistischen Darstellungen in der Schule lesen sollten, die sie in ihrer Person herabwürdigen würden. Zugleich fordert er, dass der Buchverlag eine neue, überarbeitete Version des Buches herausbringt, in dem die entsprechenden Stellen überarbeitet werden.
Auch die Ulmer Lehrerin Jasmin Blunt wendet sich gegen die Verwendung veralteter Begriffe in der Schullektüre, konkret im Roman „Tauben im Gras“ von Wolfgang Koeppen. Sie startete eine Petition gegen die Verwendung des Buches als Pflichtlektüre für das Abitur, da das Buch aufgrund des rassistischen Sprachgebrauchs nicht für die Schule geeignet sei.
Sekundarstufe I
Wahre Helden
✔ Heldinnen und Helden: Annäherung an Begriff und Thema
✔ Das Arbeitsvorhaben: differenzierte Anschreiben, Aufgaben und Bücher zur Auswahl
✔ Individuelle Ergebnisse
✔ Umsetzung: Differenzierte Hilfen und Materialien
✔Unterrichtsverlauf und Zusatzmaterialien
Kontext: Sprache formt die Realität
Forderungen wie diese bleiben nicht ohne Kritik. So heben Kritiker vor, dass die Bücher Zeugen ihrer Zeit seien und es Aufgabe der Lehrkraft ist, diese nicht unkommentiert zu lassen, sondern sich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen und die Bücher in einen Kontext zu stellen. Dies ermöglicht es uns, aus der Vergangenheit zu lernen und gleichzeitig unsere Gegenwart besser zu verstehen und aktuellen diskriminierenden Erscheinungen besser zu begegnen und für eine Gesellschaft ohne Rassismus zu kämpfen.
Gleichzeitig ist anzuerkennen, dass die Sprache viel mehr ist als nur ein reines Kommunikationsmittel. Sprache spiegelt die Bedürfnisse und Lebensumstände eine Gesellschaft wieder, aber auch Macht- und Herrschaftsstrukturen. Dies ist eins der Hauptargumente für eine Anpassung unserer Sprache, denn über sie können wir unsere Gesellschaft langfristig verbessern und etwa benachteiligte Gruppen aus der Marginalisierung helfen, indem sie sichtbarer und Vorurteile abgebaut werden.
Bremer Studie zu Vorurteilen in Schulbüchern
Das es Diskussionsbedarf über Schulbücher gibt, wird nicht nur bei dem Blick auf Romane im Deutschunterricht deutlich, sondern auch bei vermeintlich neutralen Sachbüchern. Die im Juni 2023 erschienene Studie: „Diskriminierungskritische Analyse von Schulbüchern im Land Bremen“ untersuchte die Schulbücher der neunten und zehnten Klasse aus den Bereichen Gesellschaft und Politik für Oberschulen und Gymnasien in Bremen. Die Studie kam dabei zu dem Ergebnis, dass viele der verwendeten Schulbücher implizite oder explizite rassistische, sinti- und romafeindliche, frauen- und queerfeindliche Inhalte und Abbildungen enthalten.
Zensur in Kinder- und Jugendbüchern
Neu ist das Thema bei weitem natürlich nicht. Als 2013 wieder Begriffe wie „Negerkönig“ und „Eskimofrauen“ (Begriffe aus Romanen von Astrid Lindgren und Ottfried Preußler) durch die Medien huschten, veröffentlichte die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz einen Aufsatz über die „Politische Korrektheit in Kinderbüchern„. Es zeigt sich, dass der Diskurs über die Zensur, der so alt wie die Literatur selbst ist, uns immer wieder begleiten wird. Umso wichtiger ist der durchdachte Umgang mit diskriminierenden und rassistischen Begriffen in Büchern, wie Lehrkräfte diesen im Unterricht leben. Schulbüchern, insbesondere Sachbüchern, sollte den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Diskurses widerspiegeln. Kritisch begutachten, hinterfragen, als Anstoß nehmen: das A und O ist es ohnehin, in eine Diskussion mit den Schülerinnen und Schüler zu treten.
Ausgaben passend zum Thema
- Stilmittel verstehen und anwenden (:in Deutsch/Sek I)
- Fake News (:in Deutsch/Sek I)
- Lesen: Vom Sinn und Nutzen des Umgangs mit der Literatur (Deutsch betrifft uns/Sek II)
- Sprache in politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen (Deutsch betrifft uns/Sek II))
Beiträge passend zum Thema
- Smartphones beeinflussen die Lernleistung
- Warum werden Klassiker noch in der Schule gelesen?
- Startchancen-Programm
Weiterführende Links
Viele Grüße
Deine Lehrerinsel-Redaktion