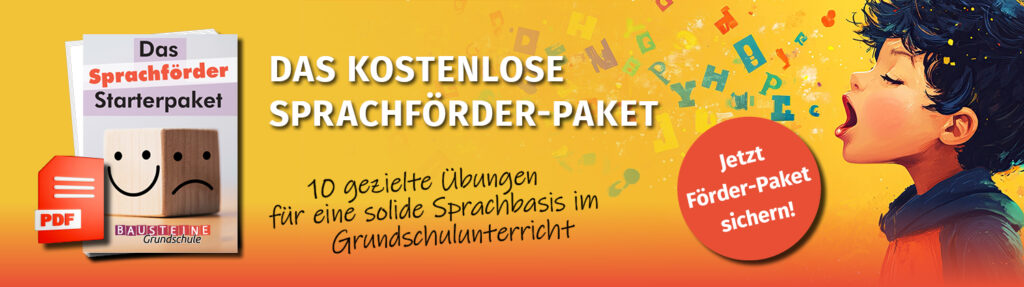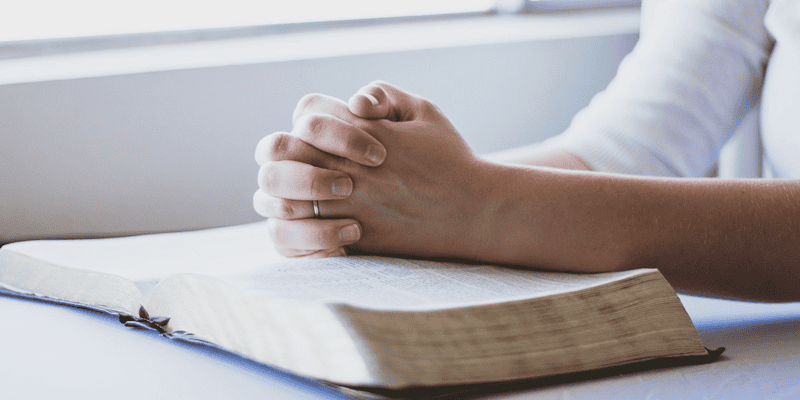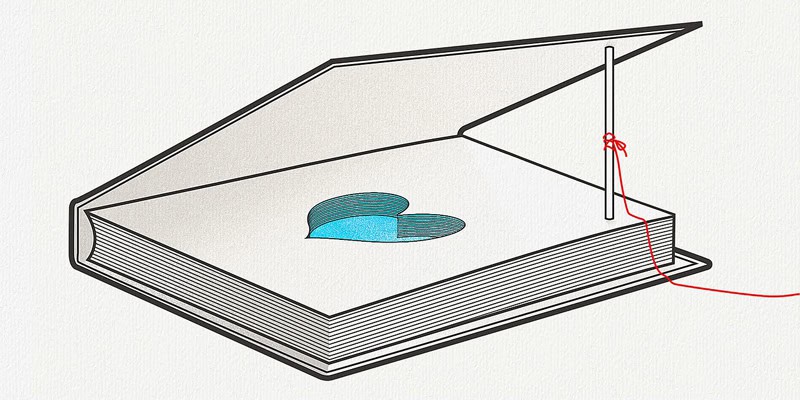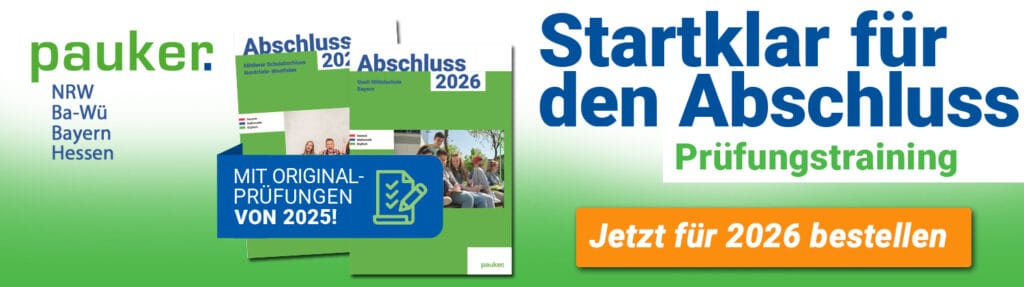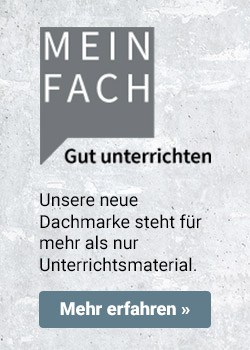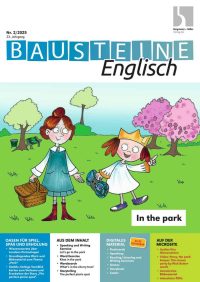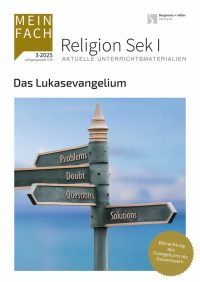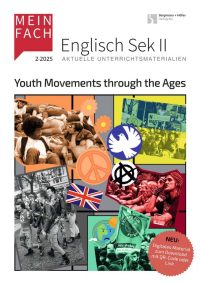Die Corona-Krise und der Ukraine-Konflikt haben vielen Menschen die internationale Verflechtung der Wirtschaft deutlich vor Augen geführt. Experten sprechen gar von einer „Globalisierungskrise“, die vorhandene Tendenzen zur Deglobalisierung verstärkt. Die starke Fokussierung auf Export (ca.45-50% des BIPs) Deutschlands macht das Thema zu einem zentralen Gegenstand des Wirtschaftsunterrichts. In diesem Beitrag zeigen wir, wie das Thema Globalisierung im Politikunterricht behandelt werden kann.
Was versteht man unter Globalisierung?
„Die Globalisierung“ existiert nicht, es gibt aber verschiedene Ausprägungen (Kultur, Wirtschaft, Politik, Ökologie und Gesellschaft) eines Phänomens. Es liegen unterschiedliche Phaseneinteilungen vor.
Die 1. Phase (1870-1914) profitierte vom rasanten Wandel der Transportmöglichkeiten und dem Abbau tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse im 19.Jahrhundert.
Die 2. Phase setzte nach 1945 mit der Etablierung eines internationalen Währungssystems und der Einrichtung internationaler Institutionen zur Regulierung des Welthandels (z.B. Weltbank und IWF) ein.
Die 3.Phase der „Hyperglobalisierung“ war seit den 1990er-Jahren geprägt von der Gründung der WTO (1995) und der Integration der davor verschlossenen Märkte des ehemaligen Ostblocks sowie Chinas in den Welthandel. Seit 2008 wird zunehmend von einer Phase der Deglobalisierung gesprochen. Die USA aber auch China scheinen eine Strategie des „Friendshorings“ zu verfolgen, d.h. Handel nur noch mit politisch zuverlässigen Partnern zu betreiben.
Zu den Dimensionen der Globalisierung vgl. Politik betrifft uns: (De-) Globalisierung: Ein Konzept am Scheideweg?, S.3-8.
Geschichte betrifft uns Ausgabe 3/2023
der Unterrichtsreihe werden ausgewählte zentrale Dimensionen der Globalisierung vorgestellt, analysiert bewertet.
Hat die Globalisierung Vorteile gebracht oder überwiegen die Nachteile?
Die Globalisierung hat die Wandlungsprozesse in der Wirtschaft beschleunigt. Die hieraus resultierende Unsicherheit wird von den Unternehmen an die Mitarbeitenden weitergegeben. Abgesehen von Ländern, die eindeutig zu den Globalisierungsgewinnern zählen wie z.B. Südkorea, haben sich in vielen Industrieländern atypische Beschäftigungsverhältnisse ausgebreitet. Unqualifizierte und darunter insbesondere Berufseinsteiger gehören zu den Absteigern der globalisierten Wissensgesellschaft. Die Auswirkungen sehen wir in der Vergrößerung der Ungleichheit in den Industrienationen (z.B. im „Rust belt“ der USA). Ricardos Theorem, wonach jedes Land vom Außenhandel profitieren könne, gilt somit nicht für alle Menschen (Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit).
Nach dem Theorem von Kaldor-Hicks erfolgt dann ein Wohlfahrtsanstieg, wenn bei einer Wohlstandsänderung die Gewinner die Verlierer kompensieren: Wenn sich der Kuchen für alle vergrößert, muss es möglich sein, diesen entsprechend umzuverteilen.
Möglichkeiten der Kompensation:
- Kompensation der Globalisierungsverlierer in den reichen Staaten: Umschulung, Qualifikation aber auch Motivation und Mobilität (neue Arbeitsplätze entstehen oft an anderer Stelle).
- Regionalpolitik
- Verbesserung des Angebots, z.B. in Italien Einführung eines besseren Rechtssystems.
- Trump erhebt 2018 Strafzölle auf Waschmaschinen und Solar, dann auf Aluminium und Stahl.
Die Notwendigkeit der Kompensation kann im Unterricht durch ein Werturteil bewertet werden.
Vgl. Politik betrifft uns: „Die Globalisierung“, zweiter Teil.
Das „Globalisierungs-Paradox“
Nach Dani Rodrik sind Globalisierung, Demokratie und Souveränität des Nationalstaats unvereinbar. Transnationale Konzerne schränken mit ihrer Machtfülle z.B. im Wettbewerb um die niedrigsten Steuersätze oder Sozialstandards die Entscheidungsspielräume der Nationalstaaten ein. Dieses „race to the bottom“ beeinflusst die demokratisch legitimierten Prozesse.
Zur Steuervermeidung und Marktmacht von Konzernen vgl. Politik betrifft uns: (De-) Globalisierung: Ein Konzept am Scheideweg?, S.9f..
Die Welt von morgen: Unipolar oder multipolar?
Der amerikanische Politologe Francis Fukuyama verkündete Anfang der 1990er-Jahre das „Das Ende der Geschichte“. Er meinte damit den Sieg des Liberalismus und die Integration von Autokratien in die internationale Arbeitsteilung. Flankiert wurde diese Prognose durch die „Modernisierungstheorie“, wonach Länder, die untereinander handeln, keine Kriege miteinander führen würden. Der wirtschaftliche Fortschritt führe dann zu Demokratisierung. Die Welt ist in dieser Perspektive unipolar.
Ein „Global village“ geprägt durch die kulturelle „McDonaldisierung“ der Supermacht USA.
Dagegen steht Samuel Huntingtons These vom „Clash of Civilizations“: Der Westen sei auf dem Rückzug; die Zukunft der Welt multipolar und multikulturell. Der Westen eroberte die Welt nicht durch überlegene Ideen und Werte, sondern durch die Anwendung organisierter Gewalt.
Nach der Theorie der hegemonialen Stabilität prägt eine dominante Führungsmacht das globale Geschehen. Die internationale Kooperation sorgt für die Einhaltung der Regeln. Im Falle der 2. Phase der Globalisierung wären dies die USA mit ihren neoliberalen Vorstellungen. Der „Konsens von Washington“ (Konferenz 1990) propagierte den Liberalismus (durch die in den USA ansässigen Weltbank/IWF) und steht im Kontrast zur wirtschaftspolitischen Intervention zahlreicher Staaten, z.B. der Aufstieg der „Tigerstaaten“ in Südostasien. Länder in schweren Krisen erhalten vom IWF Hilfen. Im Gegenzug müssen Staatsunternehmen privatisiert und Subventionen sowie Handelsbeschränkungen abgebaut werden.
Die Macht der USA wird gestützt auf die Stellung des Dollars in der Weltwirtschaft. Dieser ist immer noch „Fluchtwährung“ und bei Kapitalanlagen dominant: Im August 2023 hat der Zahlungsverkehrsdienstleister SWIFT den bislang höchsten Anteil an Dollar bei den Zahlungen registriert. Der Euro, Renminbi oder gar eine immer wieder durch Gold gedeckte eigene Währung der BRICS-Staaten konnten dieser Rolle als Weltwährung bislang nichts anhaben. Das Pro-Kopf-Einkommen der Amerikaner ist 2021 sechsmal höher als das der Chinesen. Je nach verwendeter Kennzahl tauschen die USA und China allerdings die beiden Spitzenplätze beim BIP. Es häufen sich zudem Hinweise, dass China trotz eines Mega-Projektes wie der „Neuen Seidenstraße“, einem gewaltigen Infrastrukturprogramm, kein neues Zeitalter als Hegemon prägen wird. 2023 platzt die Immobilienblase, die Arbeitslosigkeit steigt an.
Die BRICs-Staaten positionieren sich für eine andere, multipolare Weltordnung. Allerdings haben z.B. Russland, China und Indien diverse ungeklärte Grenzfragen. Die Länder des globalen Südens werden sich vermutlich nicht eindeutig zum Westen bekennen und gleichzeitig maximale Flexibilität (Matias Spektor) gegenüber China und Russland behalten. Vgl. Politik betrifft uns: „Die Globalisierung“, dritter Teil.
Auf dem Weg zur Deglobalisierung?
Die Corona-Pandemie hat vielen Menschen die Abhängigkeit von globalen Lieferketten, z.B. bei Schutzmasken, verdeutlicht. Der Ukraine-Krieg hat diese bei Energie gezeigt und damit die Tendenz zur Deglobalisierung, also der Umkehrung der Globalisierung durch Reduktion wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Verflechtungen, verstärkt. In der Handelspraxis zeigt sich dies z.B. im bilateralen Handelskonflikt zwischen China und den USA, der stark protektionistische Züge aufweist. Möglicherweise weist aber die starke Verbindung lokaler und globaler Entwicklung (Glokalisierung) den Weg in die Zukunft.
Zur Deglobalisierung und Glokalisierung vgl. Politik betrifft uns: (De-) Globalisierung: Ein Konzept am Scheideweg?, S. 11; 17ff.; 20f..
Viele Grüße
Deine Lehrerinsel-Redaktion
Ausgaben passend zum Thema
- Vom Tauschhandel bis zur Globalisierung – Die Geschichte der Wirtschaft (Bausteine Grundschule)
- Die Globalisierung – Soll Freihandel gestärkt werden? (Politik betrifft uns)
- Leben teilen in der einen Welt (:in Religion)
Beiträge passend zum Thema
- Wirtschaft schon in der Grundschule!? Echt jetzt?
- Russlands Vergangenheit – Schlüssel zu Putins Handeln?
Weiterführende Links
Entdecke das Unterrichtsmaterial
MEIN FACH - Politik Sek II
Du unterrichtest in der Sekundarstufe II und möchtest Deinen Politikunterricht fundiert und aktuell gestalten. Die Ausgaben unserer Erfolgsreihe „MEIN FACH – Politik Sek II“ unterstützt Dich durch aktuelles Unterrichtsmaterial für Politik, Sozialkunde und Wirtschaftslehre – didaktisch wertvoll aufgearbeitet.