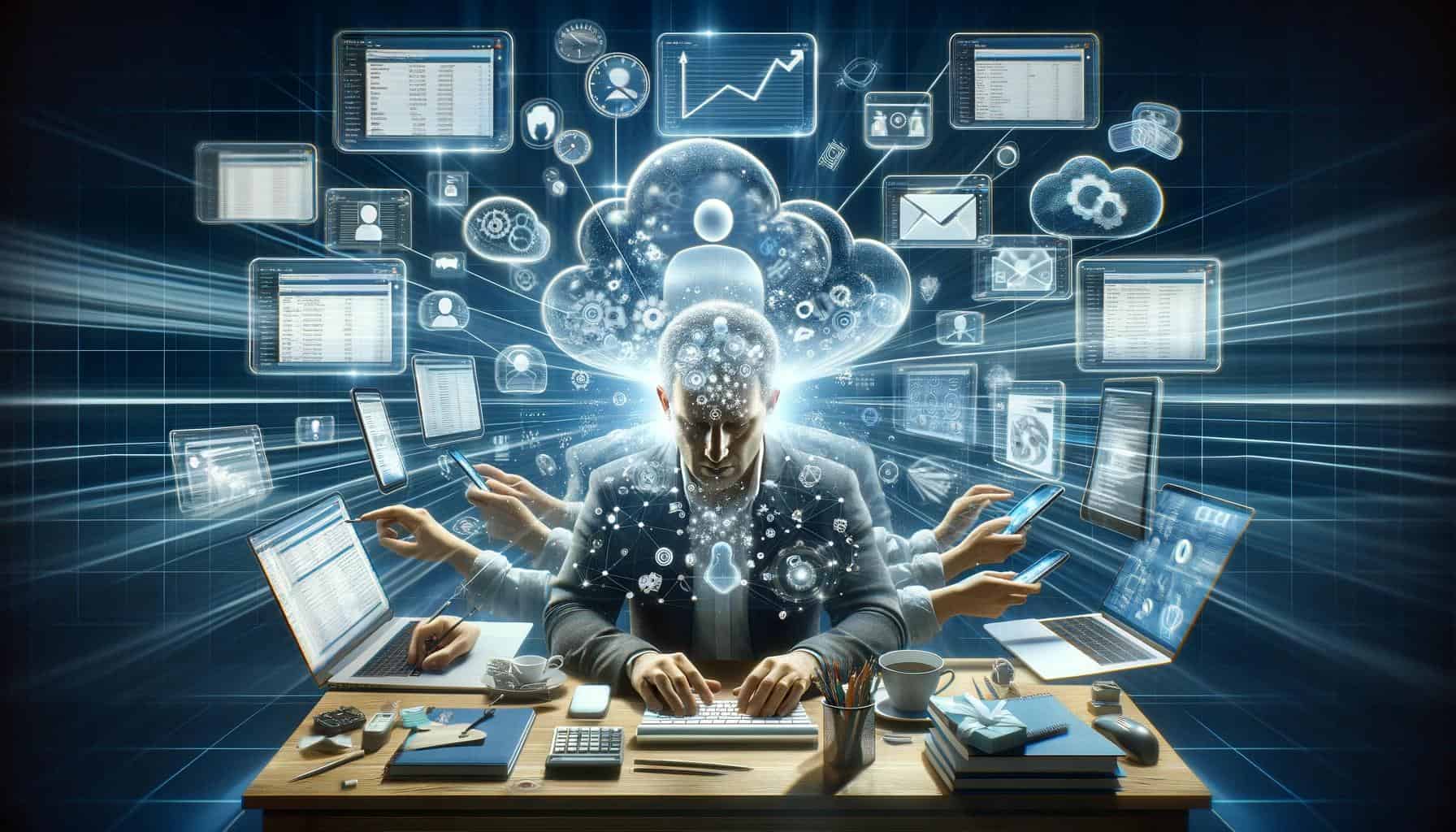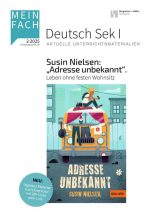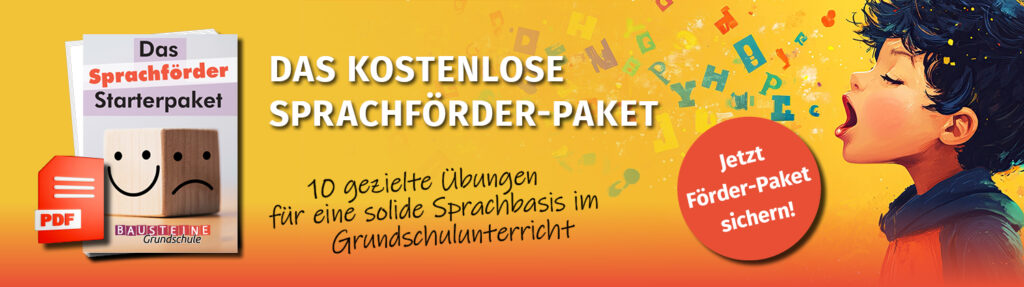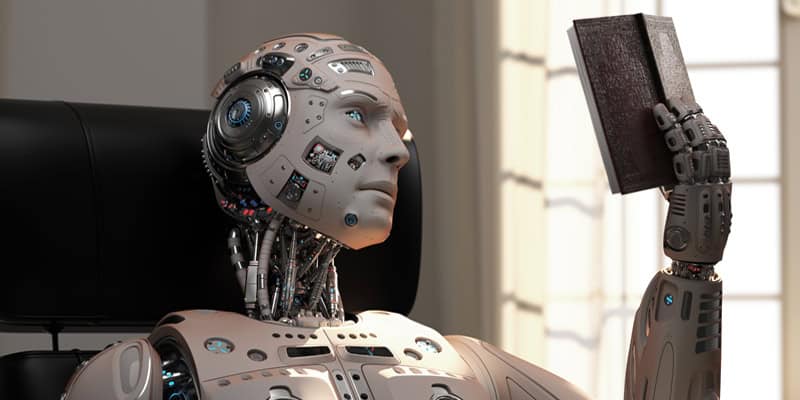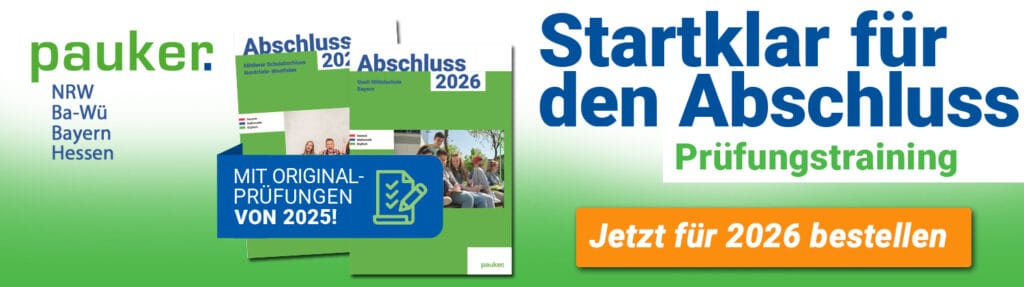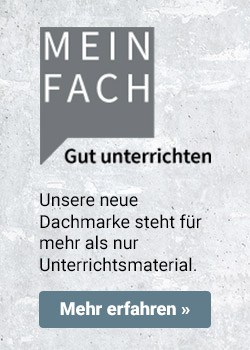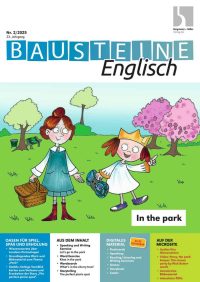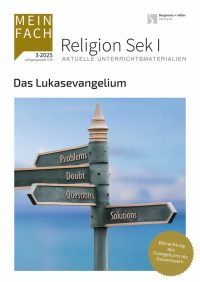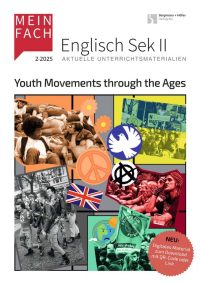Unser Smartphone haben wir immer dabei, wir sind stets erreichbar, könnten jederzeit Wissen abrufen, sind „always on“. Wir nutzen es sogar, wenn wir mit anderen Dingen beschäftigt sind: beim Fernsehen, während der Arbeit oder im Restaurant mit Freunden. Und auch bei unseren Schülerinnen und Schülern ist das Smartphone fester Bestandteil ihres Alltags. Und das hat meist negative Folgen, da wir Menschen bei weitem nicht so multitaskingfähig sind wie wir glauben. Zumindest dann nicht, wenn es um anspruchsvolle Aufgaben geht. Gerade im Rahmen der Medienerziehung ist dies ein Thema, das mit den Lernenden thematisiert werden sollte.
Multitasking, ein Begriff, der ursprünglich aus der Computerwelt stammt und die Eigenschaft eines Systems beschreibt, mehrere Aufgaben, das heißt Tasks, gleichzeitig zu erledigen, wird heute auch auf uns Menschen übertragen. Es beschreibt die Eigenschaft, mehrere Dinge gleichzeitig erledigen zu können. Durch unseren ständigen Begleiter, das Smartphone, wird Multitasking noch verstärkt. Wer besonders viele Dinge gleichzeitig erledigen kann, gilt oftmals als besonders effektiv und leistungsstark. Doch stimmt das tatsächlich?
Multitasking – ein Mythos?
Wir Menschen sind tatsächlich in gewissem Maße multitaskingfähig, wenn es um einfache Aufgaben und insbesondere Routinen geht. Kaugummikauen während einer Autofahrt, Zähneputzen und dabei auf einem Bein stehen, unsere Schuhe putzen und dabei einem Podcast zuhören, das sind Tätigkeiten, die die meisten Menschen problemlos ausführen können. Recht unproblematisch sei das, so Prof. Torsten Schubert von der Berliner Humboldt Universität bei Tätigkeiten, die wir über verschiedene Sinne wahrnehmen (z.B. Zuhören und visuelle Wahrnehmungen ). Auch gelingen uns Tätigkeiten gleichzeitig, die das gleiche Ziel verfolgen und dadurch in verschiedene „Tasks“ untergliedert werden können. Ein Beispiel dafür ist das Autofahren: wir können gleichzeitig mit dem Fuß auf die Bremse gehen, die Kupplung treten, einen Gang runterschalten und in den Rückspiegel blicken. Anders sieht es jedoch aus, wenn wir komplexere Aufgaben erfüllen müssen, wie etwas lesen und gleichzeitig fernsehen oder auf unserem Smartphone Textnachrichten beantworten.
Geschichte betrifft uns Ausgabe 1/2024
Public History, also Geschichte im Alltag, wird hier zum Thema des Unterrichts und zum Mittel für historisches Lernen. Dabei stellen die Schüler/-innen selbst handlungsorientiert Produkte der Public History her.
Komplexe Aufgaben brauchen komplette Aufmerksamkeit
Neurobiologisch gibt es kein Multitasking. Führen wir mehrere Aufgaben aus, werden im Gehirn unterschiedliche Hirnareale aktiviert. Benötigen zwei Aufgaben unterschiedliche Hirnareale, so Prof. Schubert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich stören. Da beim Multitasking unsere Aufmerksamkeit von einer zur anderen Aufgabe hin- und herspringt, benötigt unser Gehirn bei diesem Prozess mehr Energie als bei der Ausführung von Tätigkeiten der Reihe nach. Der Energieverlust geht mit einem Verlust an Konzentration einher. Das Ergebnis ist, dass wir schlussendlich weniger erledigen können, langsamer reagieren und mehr Fehler machen.
Wirtschaftspsychologin Vera Starker kam in der Studie „Kosten von Arbeitsunterbrechungen für deutsche Unternehmen“ mit Arbeitnehmer/-innen, die mindestens zweimal pro Stunde mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigten, zu dem Ergebnis, dass diese durchschnittlich zwischen 15 und 28 Prozent der Zeit verlieren. Vor allem die Digitalisierung wird in der Studie als Faktor aufgeführt, der Multitasking und damit auch das Stresserleben der Menschen massiv erhöht. Die uneingeschränkte Aufmerksamkeit bei komplexen Aufgaben und Lernprozessen ist demnach unabdingbar. Die wiederholte Unterbrechung von konzentrierten Lern- und Arbeitsprozessen wirft auch Schülerinnen und Schüler zeitlich zurück und ruft zuletzt Stress hervor.
Folgen von Multitasking
Neben negativen Auswirkungen auf unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Produktivität und Fehleranfälligkeit, kann es langfristig zu folgenden Problem kommen:
- Erhöhtes Stressempfinden und Erschöpfung
- Ein Anstieg des Cortisolspiegels. Zuviel vom Hormon Cortisol wirkt sich negativ – nun ja – auf alles aus, wie etwa unsere Leistung, aber auch unseren Muskelaufbau. Es kann Schlafstörungen und Depressionen begünstigen und das Immunsystem schwächen.
Hokus Fokus: Praxistipps für den Unterricht
Aber was hilft denn jungen Menschen nun im Schulalltag zu einer besseren Lernleistung? Laut der genannten Studie wird die Einführung einer täglichen Fokuszeit von mindestens 60 Minuten empfohlen. Dadurch wäre bereits eine Verbessung des Cortisolwerts nachweisbar. Weitere hilfreiche Mittel während oder neben der Fokuszeit wären:
- To-Do-Listen für jeden Tag (vorzugsweise analog)
- Smartphones und digitale Geräte über längeren Zeitraum ausschalten
- Konzentrationsübungen, bei unruhigen Schüler/-innen ggf. handwerkliche Aufgaben oder Fingerübungen
- Keine Musik oder andere Störquellen, ggf. Lärmschutzkopfhörer und Sichtschutz im Unterricht nutzen
Multitasking: 3 Experimente
Heiteres Multitasken wünscht
Deine Lehrerinsel-Redaktion
Ausgaben passend zum Thema
- Knobeln, tüfteln, kombinieren: Gehirnjogging (BAUSTEINE Grundschule)
- Wofür würde ich bis ans Ende der Welt gehen? (MEIN FACH – Religion Sek I)
- Demokratie und Digitalisierung (Politik betrifft uns)
Beiträge passend zum Thema
Weiterführende Links
Lehrerinsel-Autorin
… ist Gymnasiallehrerin für die Fächer Gemeinschaftskunde, Geschichte, Englisch und Wirtschaft in Baden-Württemberg.

Lehrerinsel-Autor
… ist Gymnasiallehrer für die Fächer Gemeinschaftskunde, Geschichte, Latein, Psychologie und Wirtschaft in Baden-Württemberg.

Entdecke die Unterrichtsreihe
Praxisgerechten, motivierenden Deutschunterricht gestalten: Schwerpunkt von „MEIN FACH – Deutsch Sek I“ ist der Lese- und Literaturunterricht. Jede Ausgabe besticht durch die Kombination aus begrifflich-analytischer Auseinandersetzung und produktiven Verfahren bzw. offenen Unterrichtsangeboten. Mit 6 Themen pro Jahr!