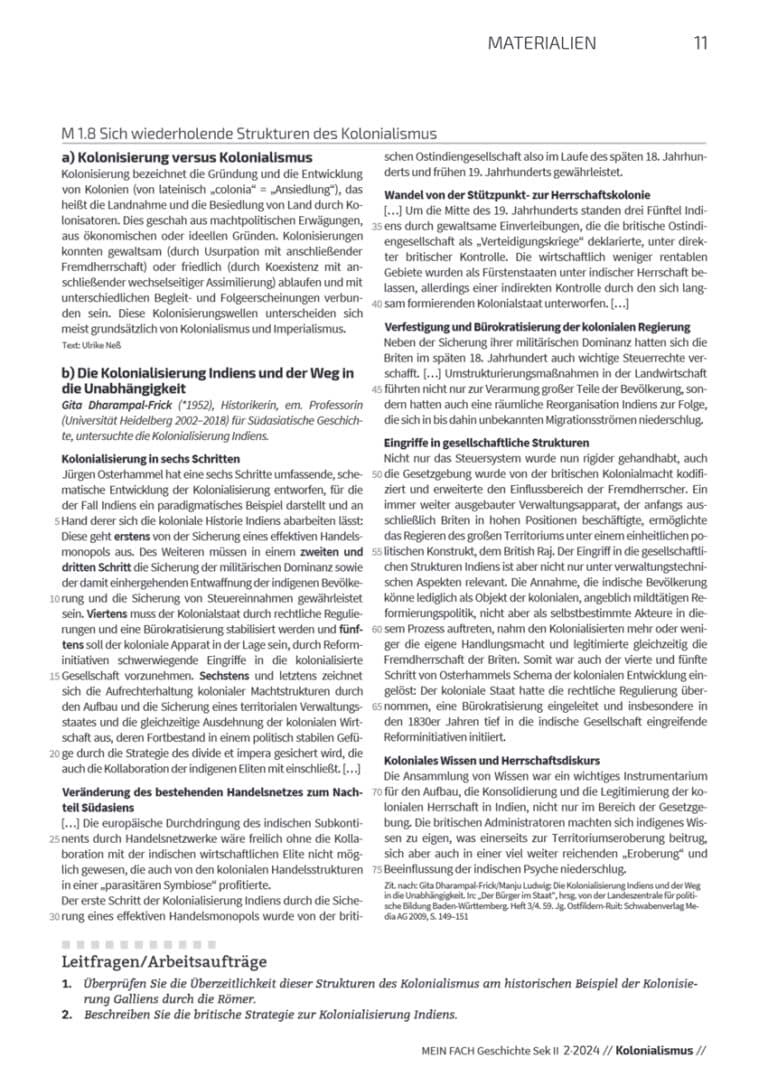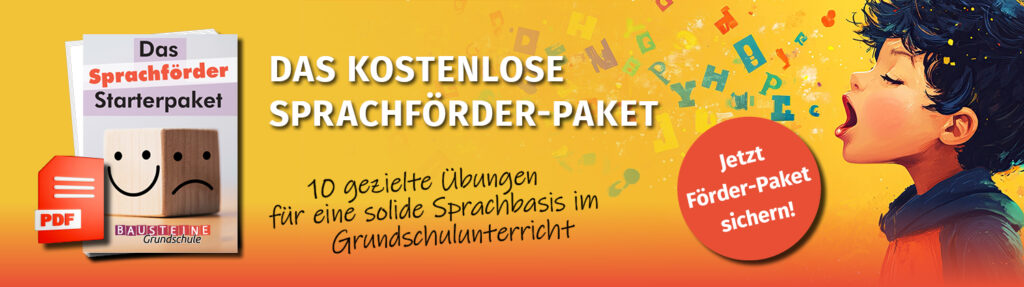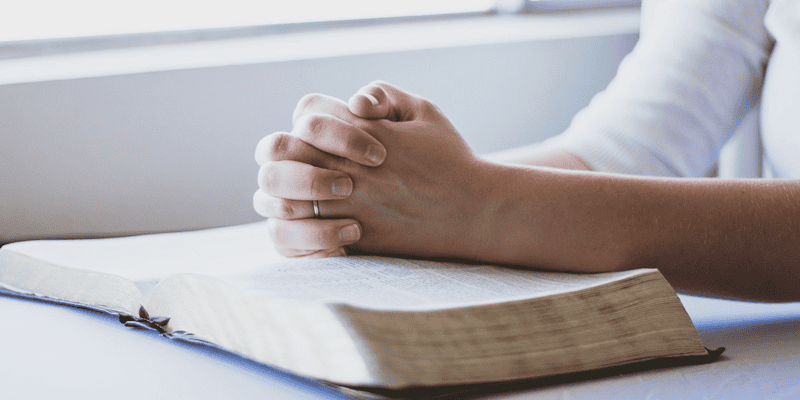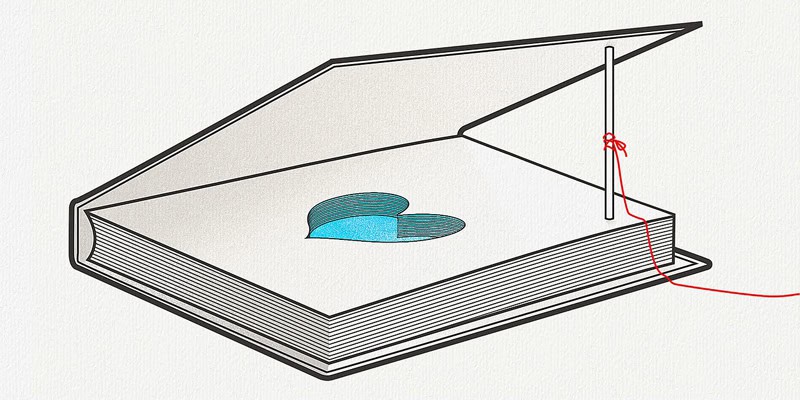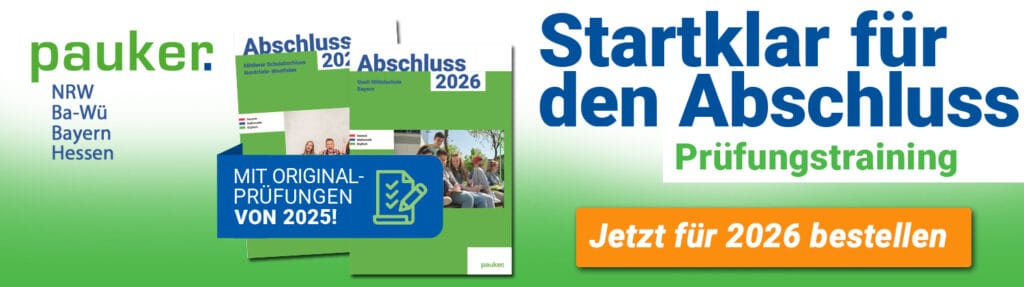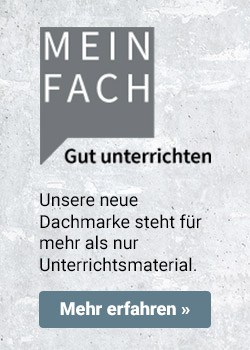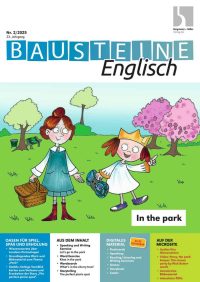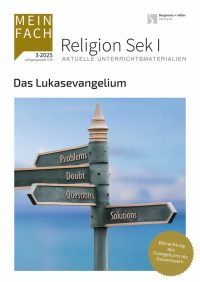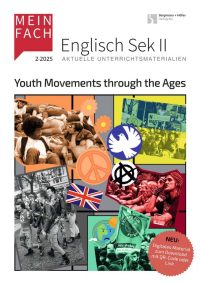Der Kolonialismus in Indien prägte das Land tief. Von den Anfängen europäischer Handelsposten bis zur Unabhängigkeit 1947 veränderte sich Indien politisch, sozial und wirtschaftlich grundlegend. In diesem Beitrag beleuchten wir die britische Herrschaft und ihr Eingreifen in die gesellschaftlichen Strukturen.
Kolonisierung versus Kolonialismus
Kolonisierung bezeichnet die Gründung und die Entwicklung von Kolonien (von lateinisch „colonia“ = „Ansiedlung“), das heißt die Landnahme und die Besiedlung von Land durch Kolonisatoren. Dies geschah aus machtpolitischen Erwägungen, aus ökonomischen oder ideellen Gründen. Kolonisierungen konnten gewaltsam (durch Usurpation mit anschließender Fremdherrschaft) oder friedlich (durch Koexistenz mit anschließender wechselseitiger Assimilierung) ablaufen und mit unterschiedlichen Begleit- und Folgeerscheinungen verbunden sein. Diese Kolonisierungswellen unterscheiden sich meist grundsätzlich von Kolonialismus und Imperialismus.
Aufgabenstellung
- Überprüfe die Überzeitlichkeit der im u.g. Text genannten Strukturen des Kolonialismus am historischen Beispiel der Kolonisierung Galliens durch die Römer.
- Beschreibe die britische Strategie zur Kolonialisierung Indiens.
Kolonialismus
Arbeitsblatt: Die Kolonialisierung Indiens
Textauszug aus der MEIN FACH-Unterrichtseinheit Kolonialismus:
Kolonialisierung in sechs Schritten
Jürgen Osterhammel hat eine sechs Schritte umfassende, schematische Entwicklung der Kolonialisierung entworfen, für die der Fall Indiens ein paradigmatisches Beispiel darstellt und an Hand derer sich die koloniale Historie Indiens abarbeiten lässt: Diese geht erstens von der Sicherung eines effektiven Handelsmonopols aus. Des Weiteren müssen in einem zweiten und dritten Schritt die Sicherung der militärischen Dominanz sowie der damit einhergehenden Entwaffnung der indigenen Bevölkerung und die Sicherung von Steuereinnahmen gewährleistet sein. Viertens muss der Kolonialstaat durch rechtliche Regulierungen und eine Bürokratisierung stabilisiert werden und fünftens soll der koloniale Apparat in der Lage sein, durch Reforminitiativen schwerwiegende Eingriffe in die kolonialisierte Gesellschaft vorzunehmen. Sechstens und letztens zeichnet sich die Aufrechterhaltung kolonialer Machtstrukturen durch den Aufbau und die Sicherung eines territorialen Verwaltungsstaates und die gleichzeitige Ausdehnung der kolonialen Wirtschaft aus, deren Fortbestand in einem politisch stabilen Gefüge durch die Strategie des divide et impera gesichert wird, die auch die Kollaboration der indigenen Eliten mit einschließt. […]
Verfestigung und Bürokratisierung der kolonialen Regierung
Neben der Sicherung ihrer militärischen Dominanz hatten sich die Briten im späten 18. Jahrhundert auch wichtige Steuerrechte verschafft. […] Umstrukturierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft führten nicht nur zur Verarmung großer Teile der Bevölkerung, sondern hatten auch eine räumliche Reorganisation Indiens zur Folge, die sich in bis dahin unbekannten Migrationsströmen niederschlug.
Eingriffe in gesellschaftliche Strukturen
Nicht nur das Steuersystem wurde nun rigider gehandhabt, auch die Gesetzgebung wurde von der britischen Kolonialmacht kodifiziert und erweiterte den Einflussbereich der Fremdherrscher. Ein immer weiter ausgebauter Verwaltungsapparat, der anfangs ausschließlich Briten in hohen Positionen beschäftigte, ermöglichte das Regieren des großen Territoriums unter einem einheitlichen politischen Konstrukt, dem British Raj. Der Eingriff in die gesellschaftlichen Strukturen Indiens ist aber nicht nur unter verwaltungstechnischen Aspekten relevant. Die Annahme, die indische Bevölkerung könne lediglich als Objekt der kolonialen, angeblich mildtätigen Reformierungspolitik, nicht aber als selbstbestimmte Akteure in diesem Prozess auftreten, nahm den Kolonialisierten mehr oder weniger die eigene Handlungsmacht und legitimierte gleichzeitig die Fremdherrschaft der Briten. Somit war auch der vierte und fünfte Schritt von Osterhammels Schema der kolonialen Entwicklung eingelöst: Der koloniale Staat hatte die rechtliche Regulierung übernommen, eine Bürokratisierung eingeleitet und insbesondere in den 1830er Jahren tief in die indische Gesellschaft eingreifende Reforminitiativen initiiert.
Koloniales Wissen und Herrschaftsdiskurs
Die Ansammlung von Wissen war ein wichtiges Instrumentarium für den Aufbau, die Konsolidierung und die Legitimierung der kolonialen Herrschaft in Indien, nicht nur im Bereich der Gesetzgebung. Die britischen Administratoren machten sich indigenes Wissen zu eigen, was einerseits zur Territoriumseroberung beitrug, sich aber auch in einer viel weiter reichenden „Eroberung“ und Beeinflussung der indischen Psyche niederschlug.
Quelle: Gita Dharampal-Frick/Manju Ludwig: Die Kolonialisierung Indiens und der Weg in die Unabhängigkeit. In: „Der Bürger im Staat“, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Heft 3/4. 59. Jg. Ostfildern-Ruit: Schwabenverlag Media AG 2009, S. 149–151
Ausgaben passend zum Thema
- Erfindung und Entdeckung – Eroberung und Unterwerfung (Geschichte betrifft uns/Sek II)
- Selbst- und Fremdbilder in der Geschichte (Geschichte betrifft uns/Sek II)
- Die USA im 19. Jahrhundert (Geschichte betrifft uns/Sek II)
Beiträge passend zum Thema
Viele Grüße
Deine Lehrerinsel-Redaktion