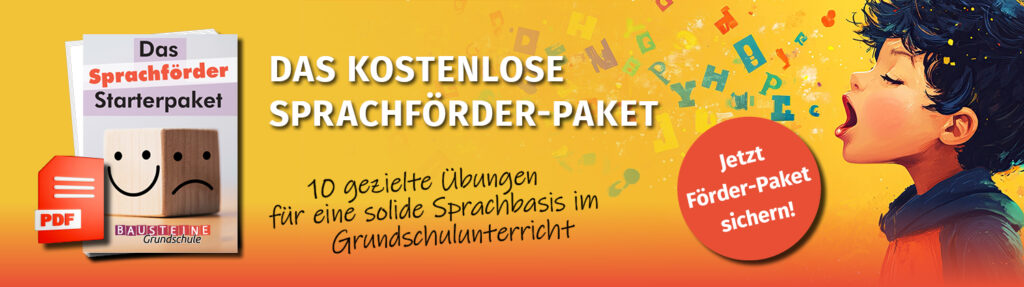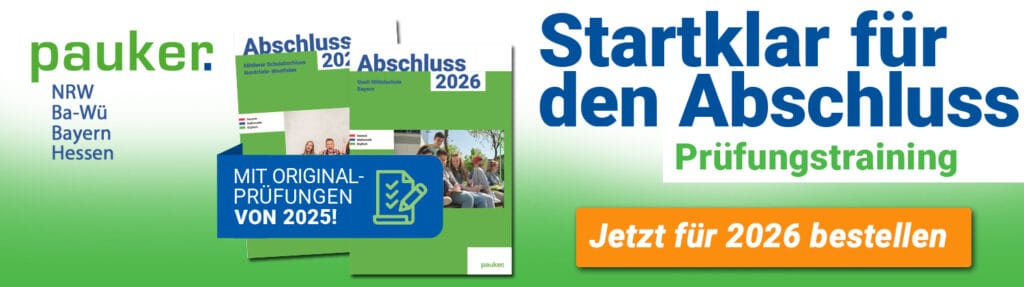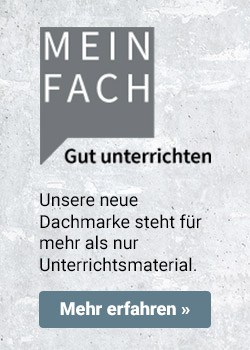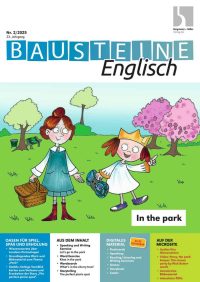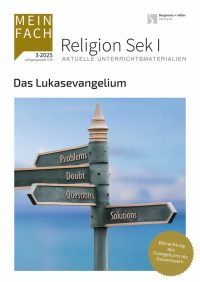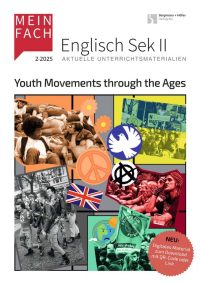Der Partei Alternativen für Deutschland (AfD) gelang in den vergangenen Jahren ein rasanter Auf-stieg. Bei der Bundestagswahl 2013 verpasste sie mit 4,7 Prozent noch knapp den Einzug, der ihr vier Jahre später gelang. In allen Landesparlamenten, abgesehen von Schleswig-Holstein und Bremen (Stand Nov. 2023,) sowie im Europaparlament ist sie mittlerweile vertreten. Mehrere Landesverbände stufen sie als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die aktuellen Erfolge der AfD werfen erneut die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Partei auf. Der CDU- Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz plädierte beispielsweise im Oktober 2023 für den Beginn eines Verbotsverfahren. Die deutsche Gesellschaft und Politik stehen deshalb im 21. Jahrhundert vor der Frage, welchen Stellenwert ihren Streitkräften zukommen soll. Mit Fragestellungen für den Politikunterricht.
Die AfD – von der Anti-Euro-Partei zum extremistischen Verdachtsfall
Die AfD wurde am 03. Februar 2013 als „Anti-Euro-Partei“ im Zuge der Finanz- und Eurokrise gegründet. Sie positionierte sich anfangs als „Alternative“ gegen die von Bundeskanzlerin Angela Merkel als „alternativlos“ bezeichneten Politik der Euro-Rettung und der damit verbundenen Griechenlandhilfen. Während die Partei von Politologen in ihrer Anfangsphase als eine liberal-konservative, euro-kritische Partei bezeichnet wurde, entwickelte sie sich mit den ersten Wahlerfolg in den ostdeutschen Bundesländern ab 2014 immer weiter Richtung Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Als die öffentliche Debatte über die Eurokrise in den Hintergrund rückte, wurde die Flüchtlingskrise“ und damit die Kritik an der Migrationspolitik zum zentralen Thema der AfD. Thematisch verschob sich der Schwerpunkt vom Wirtschaftsliberalismus zu Nationalkonservatismus.
In einigen Bundesländern, wie bspw. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wird die AfD mittler-weile als extremistischer Verdachtsfall oder als erwiesen „extremistisches Beobachtungsobjekt“ (Thüringen) eingestuft. Seit 2021 betitelt das Bundesamt für Verfassungsschutz auch die Bundes-AFD als Verdachtsfall. Somit ist der Verfassungsschutz bspw. dazu befugt, verdeckt Informationen über die Partei und die Observation von Personen zu erlangen.
Sek II
Arbeitsweisen, Methoden, Urteilsbildung
Schülerinnen und Schüler erörtern einen Arbeitsbegriff von Politik, indem sie Politik im engen und weiten Sinn unterscheiden und im Anschluss eine eigenständige Definition von Politik entwickeln.
Die Möglichkeit von Parteiverboten – das Schwert der Demokratie
Aufgrund der Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus sieht das Grundgesetz Maßnahmen zum Schutze der Demokratie vor Feinden vor (Stichwort: wehrhafte Demokratie). Nach Art 21. GG sind „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung [FDGO] zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, […] verfassungswidrig. Nur das Bundesverfassungsgericht kann über das Verbot einer Partei bei Verstößen gegen die FDGO entscheiden. Der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung können einen Antrag auf ein Parteiverbot stellen.
Parteiverbote und Verbotsanträge in der Vergangenheit
In der Geschichte der BRD gab es bisher zwei Parteiverbote. 1952 wurde die nationalsozialistisch aus-gerichtete Sozialistische Reichspartei (SRP) und 1956 die kommunistische Partei Deutschlands (KPD) verboten.
Das Verbotsantrag gegen die Nationalistische Partei Deutschlands (NPD) scheiterte hingegen zwei-mal. 2003 ist die Ursache in sogenannten Verfahrenshindernissen zu sehen. Das Einschleusen von V-Männern in die NDP, die selbst im Bundes- und in Landesvorständen tätigen waren, führte zu einer zu engen Verquickung zwischen Staat und Partei. Das Verbotsverfahren wäre, so das BVerfG, nicht mehr den Anforderungen an ein rechtsstaatliches Verfahren gerecht geworden. 2017 entschied das BVerfG, dass die Partei zwar verfassungsfeindliche Ziele verfolge, sie durch ihre geringe Größe politisch jedoch zu unbedeutend sei, um diese erfolgreich umzusetzen.
TIPP Im Unterricht kann die oben erörterte Entwicklung etwa anhand der „Good Angel-Bad Angel“-Methode diskutiert werden, bei welcher die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit den Gewissenskonflikt einer Person oder Thematik herausarbeiten.
Wie sollte mit der AfD umgegangen werden?
Für den Umgang mit der AfD lassen sich vier mögliche Strategien ausmachen, die allesamt Risiken bergen.
- Ausgrenzen, d.h. „Verbieten“ der Partei: Ein Parteienverbot ist jedoch an hohe Hürden geknüpft. Aus einem gescheiterten Verbotsverfahren könnte die Partei gestärkt hervorgehen.
- Umarmen der Partei: Um Wähler und Wählerinnen zurückzugewinnen, übernehmen die etablierten Parteien zum Teil Positionen der AfD (z.B. im Feld der Migrations- und Asylpolitik). Die Strategie kann dazu führen, dass die AfD in der Öffentlichkeit aufgewertet und dadurch weiter gestärkt wird.
- Punktuelle Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit der AfD bei gewissen Sachfragen (z.B. Sanierung von Schulen), indem Anträge der Partei unterstützt werden. Auch hier droht die Gefahr der Stärkung der Partei durch ihre Normalisierung.
- Abgrenzen ohne Ausgrenzen: Hier steht die Überzeugung im Vordergrund, dass demokratisch gewählte Abgeordnete vom politischen Diskurs nicht ausgegrenzt werden dürfen und kein Verbotsverfahren angestrebt werden sollte. Eine Kooperation wird aber aufgrund von Positionen, die gegen die FDGO verstoßen, ausgeschlossen.
Mit der Etablierung der AfD im Parteiensystem hat sich dieses von einem Fünf- zu einem Sechsparteiensystem gewandelt. Klassische Koalitionsregierungen aus zwei Parteien (rot-grün oder schwarz-gelb) werden immer unwahrscheinlicher. Wenn die AfD weiter an Stimmen gewinnt und Koalitionen mit der AfD ausgeschlossen bleiben, werden Koalitionsverhandlungen zukünftig schwieriger, wenn sie aus drei oder mehr Parteien bestehen. Bei einem Parteiverbotsverfahren wie auch beim „Abgrenzen“ sollte die Wahlergebnisse der Partei nicht vergessen werden und damit das Ausgrenzen ihrer Wählerschaft (bspw. bei Wahlen in Ostdeutschland tlw. über 20%).
Die AfD – ein Thema im Politikunterricht?
Darf ich mich als Lehrerin bzw. als Lehrer in der Schule überhaupt mit der AfD und einem möglichen Verbot befassen? Das Neutralitätsgebot, wie es sich aus dem Beutelsbacher Konsens ableiten lässt, verbiete, so die Partei selbst, negative Kritik an der Partei. Allerdings darf in diesem Zusammenhang das Neutralitätsgebot nicht mit einer Wertneutralität verwechselt werden. Der Gesetzgeber sieht vor, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern die freiheitlichen Grund- und Menschenrechte vermitteln, wie sie im Grundgesetz verankert sind. Verstöße gegen diese zu thematisieren ist somit im Zuge der Demokratieförderung im Einklang mit dem Bildungsauftrag und darf Gegenstand des Schulunterrichtes sein. Wichtig dabei ist, dass wir den Lernenden unterschiedliche Sichtweisen präsentieren und ihnen so die Möglichkeit geben, sich ein eigenes Urteil zu bilden.
Die AfD als Gast bei Podiumsdiskussionen in der Schule?
Das Frankfurter Heinrich-von-Gagern-Gymnasium machte im Oktober 2023 Schlagzeilen, als anlässlich einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl auch eine Vertreterin der AfD eingeladen wurde. Ehemalige Schülerinnen und Schüler hatten sich mit einem Protestschreiben an die Schulleitung gewandt. Diese hatte alle im Landtag vertretenen Parteien eingeladen. Und damit ist das Frankfurter Gymnasium nicht das erste, das Schlagzeilen macht. Der Schulleiter Gerhard Köhler argumentierte, dass es zum politischen Diskurs gehöre, sich auch mit denjenigen auseinanderzusetzen, deren Meinung man selbst nicht vertrete. Die Pflicht zur Neutralität und der Transparenz gebiete dies. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Chance bekomme, sich ein vollständiges Bild der politischen Landschaft zu bilden, um dadurch informierte Entscheidungen treffen zu können. Anderenfalls bestehe die Gefahr, dass sich die Partei als „Opfer“ stilisiere. Kritikerinnen und Kritiker lehnen es hingegen ab, einer Partei, die gegen die FDGO verstößt, eine Bühne zu geben. Ob die Partei eingeladen wird, hängt letzten Endes von der Einschätzung der Schulleitung ab. Bei Bedenken ist es zudem ratsam, sich an das Schulamt bzw. die zuständigen Behörden zu wenden.
Behandlung im Unterricht
Die Thematik lässt sich im Unterricht gut in Form eines Rollenspieles oder einer Podiumsdiskussion behandeln. Der folgende Vorschlag eignet sich für die obere Mittelstufe und Oberstufe.
- Einstieg: Die SuS positionieren sich auf einer Skala von -2 (nein) – 1 (eher nein) – 0 (weder nein noch ja) – 1 (eher ja) und 2 (ja) bspw. zu folgenden Statements:
– „Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Die anderen Parteien sollten mit der AfD zusammenarbeiten“
– „Eine Zusammen-arbeit der etablierten Parteien mit der AfD ist inakzeptabel“
– „Bei gewissen Sachverhalten (z.B. Bau von Schule), darf mit der AfD kooperiert werden“
– „Die AfD ist eine Gefahr für die Demokra-tie und sollte verboten werden“
Die SuS positionieren sich und begründen ihre Position. - Die Lehrkraft führt den Begriff der „wehrhaften Demokratie“ und die Möglichkeiten eines Parteienverbotes ein bzw. der Erörterung, wie sinnvoll ein Parteienverbot wäre.
- Die SuS bereiten Rollenkarten mithilfe einer Internetrecherche zu den vier Strategien (s.o.) vor.
- Die SuS beantworten die Einstiegsfragen erneut und begründen, ob sich ihre Position verändert hat.
Unterrichtsmaterial passend zum Thema
- Wandel der Parteienlandschaft (Politik betrifft uns/Sek II)
- Die Alternative für Deutschland (Politik betrifft uns/Sek II)
- Europäische Union (MEIN FACH Politik Sek II)
Beiträge passend zum Thema
Lehrerinsel-Autorin
… ist Gymnasiallehrerin für die Fächer Gemeinschaftskunde, Geschichte, Englisch und Wirtschaft in Baden-Württemberg.

Lehrerinsel-Autor
… ist Gymnasiallehrer für die Fächer Gemeinschaftskunde, Geschichte, Latein, Psychologie und Wirtschaft in Baden-Württemberg.